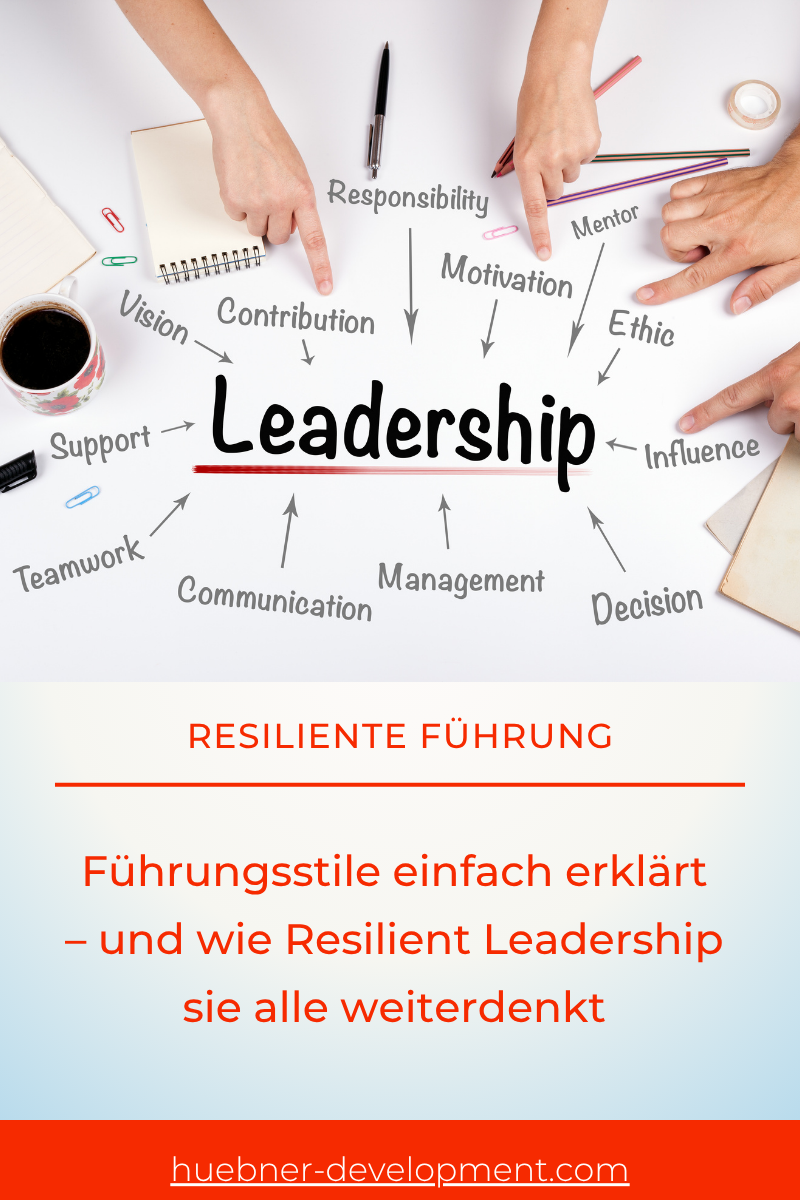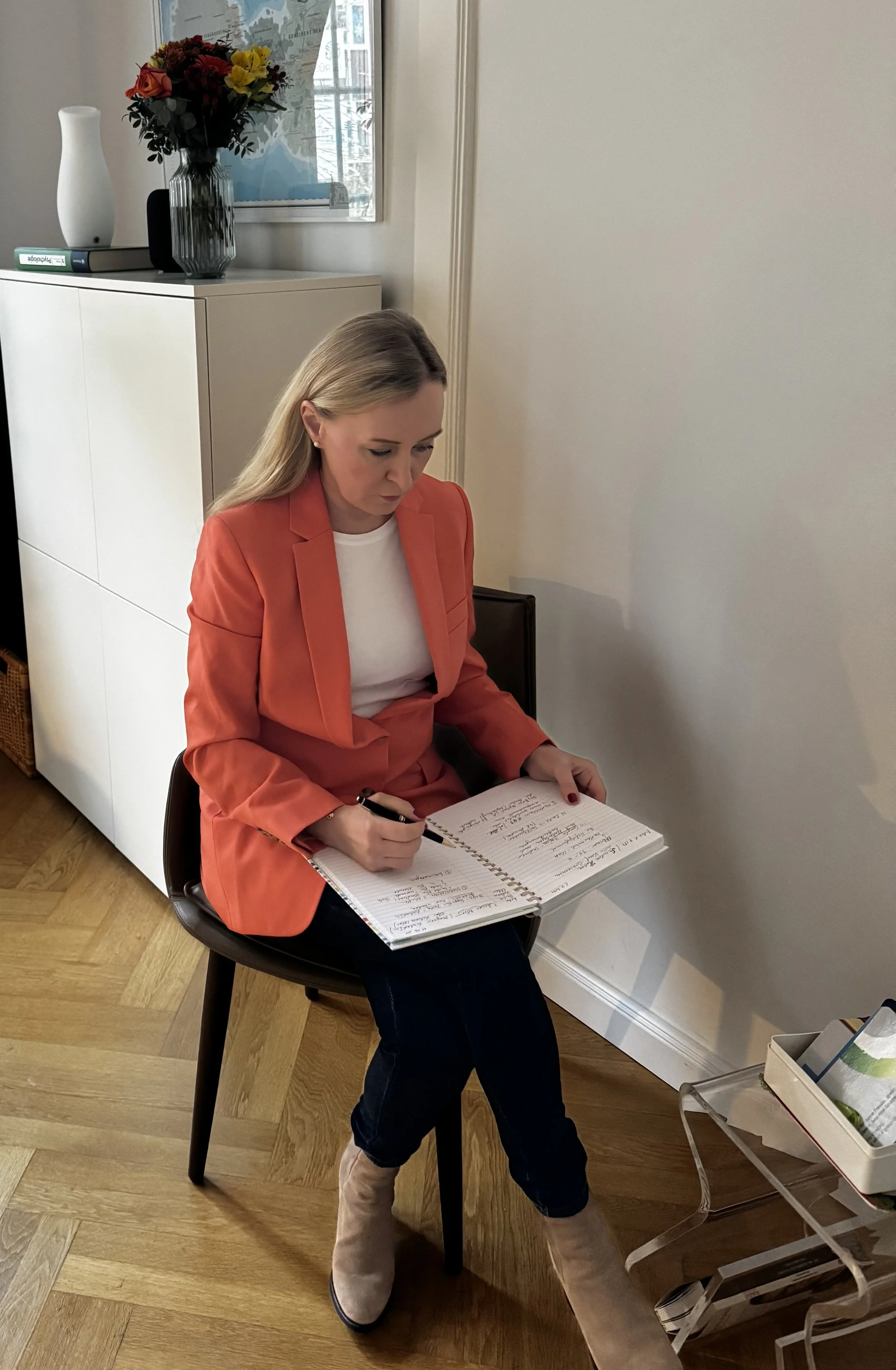Führungsstile einfach erklärt – und wie Resilient Leadership sie alle weiterdenkt
Einleitung
Wenn wir über Führung sprechen, erinnern sich viele noch an Zeiten, in denen alles vermeintlich einfacher war. Rollen waren klar, Wege vorhersehbar, Märkte stabil. Man führte entlang von Strukturen, Regeln und Plänen. Vieles ließ sich kontrollieren – und wer Kontrolle hatte, konnte führen.
Heute fühlt sich Führung anders an. Schneller. Vielschichtiger. Oft widersprüchlich.
Teams arbeiten hybrid, Projekte verändern sich über Nacht, Fachkräfte fehlen, Erwartungen steigen. Und während die Komplexität zunimmt, bleibt die Verantwortung – häufig sogar stärker als früher.
Viele Führungskräfte spüren genau diesen Druck. Sie wollen verlässlich handeln, ihre Teams stärken, ihre Ziele erreichen – und gleichzeitig menschlich bleiben. Doch klassische Führungsstile greifen oft zu kurz. Sie erklären, wie jemand führt, aber nicht, warum eine Führungskraft auch dann klar bleibt, wenn der Alltag wackelt.
Genau hier entsteht der Unterschied:
Resilient Leadership ist kein weiterer Stil. Es ist eine Haltung, die alle Stile weiterdenkt.
Sie hilft, bewusst zu führen – auch wenn Unsicherheit, Tempo oder Emotionen steigen. Sie macht sichtbar, was gute Führung heute wirklich braucht: innere Stabilität, Klarheit, Präsenz und ein gesundes Verhältnis zu Verantwortung.
Führung verändert sich. Und sie braucht Führungskräfte, die mitgehen – nicht indem sie immer mehr leisten, sondern indem sie bewusster führen.
Dieser Artikel zeigt dir, wie klassische Führungsstile funktionieren, wo sie wirken, wo sie scheitern – und wie Resilient Leadership daraus etwas schafft, das in unserer heutigen Arbeitswelt trägt.
Hallo, ich bin Kasia Hübner
Resilienz-Expertin, Systemische Mental Business & Leadership Coach, Unternehmensberaterin
Als Spezialistin für resiliente Persönlichkeisentwicklung und wertschätzende Führungskultur zeige ich Dir, wie Du Deine Arbeits- und Lebensqualität im stressigen Businessalltag verbesserst.
Hier auf meinem BLOG findest Du Impulse über Business Resilienz, wertschätzende Führungskultur und eine gesunde Arbeitsweise.
#1. Autoritärer Führungsstil
Es gibt Momente, in denen ein Team nicht diskutieren möchte, sondern Orientierung braucht. Genau dort zeigt sich der autoritäre Führungsstil: Entscheidungen kommen von oben, die Richtung steht fest, der Weg ist vorgegeben. Wer so führt, hält das Steuer fest in der Hand. Mitarbeitende setzen um, ohne lange nachzufragen.
So funktioniert der autoritäre Führungsstil:
Die Führungskraft entscheidet allein. Sie gibt klare Anweisungen und erwartet, dass das Team diese zügig umsetzt. Die Kommunikation verläuft eher von oben nach unten. Es geht um Tempo, Struktur und Kontrolle.
Das kann wirken, wenn:
Situationen schnell eskalieren können oder jede Minute zählt.
Ein Team braucht dann jemanden, der den Nebel wegschiebt, Verantwortung übernimmt und klare Schritte vorgibt.
Im Krisenmodus kann diese Führung Sicherheit geben – nicht als Machtinstrument, sondern als Orientierungspunkt.
Aber:
Wenn dieser Stil zum Dauerzustand wird, kippt er schnell. Kontrolle erzeugt Abhängigkeit, erstickt Ideen und macht Menschen kleiner, als sie sind. Teams verlieren den Mut, mitzudenken. Kreativität bleibt liegen. Fehler werden versteckt – aus Angst statt aus Verantwortung.
Viele Führungskräfte greifen in Stressphasen unbewusst wieder auf diesen Stil zurück. Nicht, weil sie kontrollieren wollen, sondern weil sie sich selbst unsicher fühlen. Doch genau hier entscheidet sich, ob Führung eng macht oder stärkt.
Resilient weitergedacht:
Klarheit bleibt wichtig – gerade unter Druck. Aber Klarheit braucht nicht zwingend Härte. Sie wirkt ruhiger, wenn sie aus innerer Stabilität kommt.
Resilient führen heißt nicht, dass man nicht entscheidet. Es heißt, dass man bewusst entscheidet – ohne Angst, ohne Dominanz, ohne Druck.
Resilient führen heißt:
Ich entscheide entschlossen – und bleibe dabei offen für Feedback.
So entsteht Führung, die Orientierung gibt, ohne Menschen klein zu halten. Führung, die stärkt statt begrenzt. Führung, die trägt – auch dann, wenn es eng wird.
Autoritärer Führungsstil
So funktioniert er: Entscheidungen kommen von oben, Mitarbeitende setzen um.
Das kann wirken, wenn: schnelle Orientierung und Krisenmanagement nötig sind.
Aber: Kontrolle hemmt Verantwortung und Kreativität.
Resilient weitergedacht: Klarheit bleibt – aber ohne Druck. Führung wird ruhiger, nicht härter.
Resilient führen heißt: Ich entscheide entschlossen – und bleibe dabei offen für Feedback.
#2. Patriarchalischer Führungsstil
Der patriarchalische Führungsstil wirkt auf den ersten Blick warm. Er kommt mit Fürsorge, Schutz und der Haltung: „Ich kümmere mich um euch.“
Entscheidungen trifft die Führungskraft allein – in der Überzeugung, das Richtige fürs Team zu tun. Für viele fühlt sich das erst einmal angenehm an: Man muss nicht viel abwägen, bekommt Orientierung und das Gefühl, „jemand passt auf uns auf“.
So funktioniert der patriarchalische Führungsstil:
Die Führungskraft entscheidet selbstständig, holt selten aktiv Meinungen ein und vermittelt: „Ich weiß, was gut für euch ist.“ Es schwingt eine fast familiäre Note mit. Loyalität zählt. Vertrauen entsteht durch Nähe, nicht durch Transparenz oder Beteiligung.
Das kann wirken, wenn:
Das Team klein ist, eng zusammenarbeitet und eine persönliche Bindung zur Führungskraft hat. In solchen Strukturen kann dieser Stil tatsächlich Sicherheit geben. Menschen fühlen sich gesehen und geschützt, Entscheidungen laufen schnell, Konflikte werden oft im direkten Austausch gelöst.
In manchen Familienunternehmen oder Start-ups taucht dieser Stil immer noch auf – manchmal aus Tradition, manchmal aus echter Fürsorge.
Aber:
So viel Nähe hat eine Kehrseite. Wenn nur eine Person entscheidet, bleibt das Team abhängig.
Fürsorge kann unbemerkt Grenzen setzen:
Menschen lernen weniger selbst zu entscheiden.
Kritik bleibt unausgesprochen, weil man niemanden „verletzen“ will.
Verantwortung bleibt dort hängen, wo sie nicht dauerhaft hingehört.
Und irgendwann fühlen sich Mitarbeitende eher „geführt“ als „befähigt“. Das bremst Entwicklung, Innovation – und langfristig auch die Motivation.
Resilient weitergedacht:
Fürsorge verliert nichts von ihrem Wert. Aber sie verändert ihre Richtung.
Nicht „Ich halte euch klein, damit ihr sicher bleibt.“
Sondern: „Ich unterstütze euch, damit ihr wachsen könnt.“
Resilient Leadership trennt Fürsorge von Bevormundung.
Es hält Verbindung, ohne Verantwortung zu monopolisieren.
Resilient führen heißt:
Ich sorge für mein Team – indem ich es befähige, selbst zu tragen.
Das schafft Zugehörigkeit, ohne Menschen klein zu halten. Und es schafft Vertrauen, das bleibt – auch dann, wenn die Führungskraft einmal nicht da ist.
Patriarchalischer Führungsstil
So funktioniert er: Die Führungskraft entscheidet allein, aber „zum Wohl der Mitarbeitenden“.
Das kann wirken, wenn: das Team klein, vertraut und loyal ist.
Aber: paternalistische Fürsorge kann abhängig machen und Entwicklung bremsen.
Resilient weitergedacht: Verantwortung teilen, ohne Zugehörigkeit zu verlieren.
Resilient führen heißt: Ich sorge für mein Team – indem ich es befähige, selbst zu tragen.
RESILIENCE WALK & TALK
Der Resilienz Coaching-Spaziergang im Hamburger Stadtpark
Baue Stress ab und bringe frischen Schwung in Deine Gedanken
Du bestimmst die Themen und das Tempo.
Ich navigiere Dich durch den Weg und unterstütze mit Fragen und kleinen Übungen.
1,5 Std. morgens, nachmittags oder abends
#3. Beratender Führungsstil
Der beratende Führungsstil bewegt sich zwischen Klarheit und Beteiligung. Die Führungskraft trifft am Ende selbst die Entscheidung – holt aber vorher bewusst Stimmen, Perspektiven und Fachwissen aus dem Team ein. Es ist ein Stil, der Dialog zulässt, aber die Verantwortung nicht abgibt. Und genau deshalb fühlt er sich für viele Menschen modern und nahbar an.
So funktioniert der beratende Führungsstil:
Eine Entscheidung steht an – und bevor die Führungskraft sie trifft, fragt sie nach Einschätzungen, Risiken, Chancen und Erfahrungen der Mitarbeitenden. Sie hört zu, stellt Rückfragen, sammelt Argumente und klärt offene Punkte. Das Team erlebt: „Meine Meinung zählt.“
Doch die Entscheidungsgewalt bleibt klar bei der Führungskraft.
Das kann wirken, wenn:
Die Situation komplex ist und verschiedene Perspektiven gebraucht werden.
Wenn niemand allein genug Informationen hat.
Wenn es sinnvoll ist, Expertise zu bündeln – ohne die Verantwortung zu verwässern.
Viele strategische Entscheidungen profitieren von diesem Stil:
Eine neue Ausrichtung, ein schwieriges Projekt, ein riskanter Schritt.
Das Team fühlt sich einbezogen, und die Führungskraft bekommt ein vollständigeres Bild.
Aber:
Wenn alles besprochen wird, verliert sich Führung schnell im Kreis.
Endlose Abstimmungen, verpasste Deadlines, zu viele Meinungen – und plötzlich weiß niemand mehr, worum es eigentlich ging. Diskussionen können lähmen, wenn sie keinen Rahmen haben.
Und manche Themen brauchen schlicht keine Runde, sondern eine klare Entscheidung.
Resilient weitergedacht:
Offenheit ist wertvoll – aber Offenheit ohne Fokus verwirrt.
Resiliente Führung nutzt Austausch, um Klarheit zu gewinnen, nicht um sie zu verlieren.
Sie hört wirklich zu, filtert das Wesentliche heraus und hält die Richtung.
Resilient führen heißt:
Ich höre zu, wäge ab – und stehe dann klar zu meiner Entscheidung.
So entsteht eine Führung, die Menschen einbindet, ohne sich zu verzetteln.
Klar. Wertschätzend. Und handlungsfähig – gerade dann, wenn es darauf ankommt.
Beratender Führungsstil
So funktioniert er: Die Führungskraft entscheidet, bezieht aber aktiv Meinungen und Ideen des Teams ein.
Das kann wirken, wenn: komplexe Entscheidungen vorbereitet werden müssen.
Aber: zu viel Diskussion kann lähmen.
Resilient weitergedacht: Offenheit braucht Fokus.
Resilient führen heißt: Ich höre zu, wäge ab – und stehe dann klar zu meiner Entscheidung.
#4. Kooperativer Führungsstil
Der kooperative Führungsstil klingt für viele wie das Idealbild moderner Zusammenarbeit: gemeinsam denken, gemeinsam entscheiden, gemeinsam tragen. Teams bringen Ideen ein, diskutieren Lösungen und gestalten die nächsten Schritte aktiv mit.
Wenn alles gut läuft, entsteht eine Energie, die man spürt. Menschen fühlen sich verantwortlich, verbunden und motiviert.
So funktioniert der kooperative Führungsstil:
Die Führungskraft öffnet den Raum für Austausch. Sie lädt das Team ein, mitzudenken, zu hinterfragen und Alternativen vorzuschlagen. Entscheidungen werden im Dialog entwickelt.
Die Verantwortung liegt nicht allein auf den Schultern der Führungskraft – sie verteilt sich. Das stärkt das Wir-Gefühl und fördert echte Beteiligung.
Das kann wirken, wenn:
Das Team erfahren ist, Vertrauen lebt und Lust hat, aktiv zu gestalten.
Kooperative Führung entfaltet besonders dann Kraft, wenn Menschen mutig denken, sich einbringen und gemeinsam eine Lösung tragen wollen.
In solchen Momenten entsteht eine Art kollektive Intelligenz – jeder bringt sein Wissen und seine Erfahrung ein, und das Ergebnis wird besser als die Summe der Einzelbeiträge.
Aber:
Kooperation kippt schnell, wenn niemand die Richtung hält.
Wenn alles besprochen wird, aber nichts entschieden.
Wenn Harmonie wichtiger wird als Klarheit.
Dann verschwimmen Rollen, Diskussionen ziehen sich, und Entscheidungen verzögern sich so lange, bis niemand mehr weiß, worum es eigentlich ging.
Das frustriert – und macht Teams unsicher.
Resilient weitergedacht:
Kooperation braucht Struktur, sonst verliert sie ihren Wert.
Resiliente Führung öffnet den Raum, aber setzt einen Rahmen.
Sie fördert Beteiligung, ohne die Entscheidungsstärke zu verlieren.
Sie sagt klar, wann das Team mitreden kann – und wann Führung entscheiden muss.
Resilient führen heißt:
Ich fördere Beteiligung – und sorge gleichzeitig für Richtung.
So fühlt sich kooperative Führung nicht wie endlose Abstimmung an, sondern wie echte Zusammenarbeit: mutig, klar, verbindlich – und handlungsfähig.
Kooperativer Führungsstil
So funktioniert er: Entscheidungen entstehen gemeinsam, Verantwortung wird geteilt.
Das kann wirken, wenn: das Team reif, motiviert und erfahren ist.
Aber: zu viel Konsens verwischt Grenzen, Entscheidungen dauern.
Resilient weitergedacht: Kooperation braucht Klarheit.
Resilient führen heißt: Ich fördere Beteiligung – und sorge gleichzeitig für Richtung.
Exkurs: Die Kontinuum-Theorie nach Tannenbaum & Schmidt
Bevor wir weitergehen, lohnt sich ein kurzer Blick auf ein Modell, das viele Führungskräfte kennen – aber selten bewusst nutzen: das Führungskontinuum von Tannenbaum & Schmidt.
Es beschreibt nicht „den einen richtigen Führungsstil“, sondern die Spannbreite zwischen klarer Entscheidung durch die Führungskraft und voller Beteiligung des Teams.
Das Kontinuum in Kurzform:
autoritäres Entscheiden – die Führungskraft trifft die Entscheidung allein
patriarchalisches Entscheiden – sie entscheidet und erläutert
beratendes Vorgehen – sie entscheidet nach vorherigem Einholen von Meinungen
konsultatives Vorgehen – sie schlägt vor, das Team diskutiert, sie entscheidet
partizipatives Entscheiden – die Entscheidung entsteht in der Gruppe
delegatives Vorgehen – das Team entscheidet selbstständig, Führung begleitet
Zwischen diesen Punkten verläuft kein harter Schnitt. Führung bewegt sich fließend – abhängig vom Auftrag, vom Team und vom Druck, der gerade im Raum steht.
Viele Führungskräfte wandern unbewusst über dieses Kontinuum.
Mal brauchen sie Geschwindigkeit. Mal Perspektiven. Mal Orientierung. Mal Beteiligung.
Genau deshalb greifen starre Führungsstil-Schubladen zu kurz.
Was Resilient Leadership damit macht
Resilient Leadership interpretiert dieses Kontinuum nicht nur als Frage der Machtverteilung, sondern der inneren Haltung:
Nicht nur wer entscheidet, zählt –
sondern wie stabil, klar und präsent alle Beteiligten bleiben, während sie entscheiden.
Ob die Führungskraft gerade allein entscheidet oder Verantwortung ans Team übergibt –
Führung wirkt nur dann gesund, wenn sie auf Selbstregulation, Bewusstheit und Klarheit basiert.
Resilient Leadership hilft dabei, auf diesem Kontinuum bewusst zu stehen –
statt reflexhaft zu reagieren oder im Stress in alte Muster zu rutschen.
So wird das Kontinuum nicht zum theoretischen Modell,
sondern zu einer Landkarte für echte Führungssituationen:
flexibel, menschlich und auf den Moment abgestimmt.
STÄRKEN-COACHING
für FÜHRUNSGKRÄFTE, MANAGER & ENTSCHEIDER in Organisationen, Unternehmen und Konzernen
Wenn Du Deine Stärken und Potentiale richtig kennst, kannst Du sie auch gezielt einsetzen, statt in Aufgaben zu verharren, die unnötig Kraft rauben und Stress machen.
Wenn Du Deine Stärken richtig einsetzt, kannst Du Dein Wirken und den eigenen Weg in die gewünschte Richtung lenken.
#5. Transaktionaler Führungsstil
Der transaktionale Führungsstil wirkt auf den ersten Blick sehr ordentlich. Alles hat seinen Platz. Ziele sind klar, Kennzahlen sichtbar, Zuständigkeiten geregelt. Leistung steht im Zentrum – und wer liefert, bekommt etwas zurück. Bonus, Anerkennung, eine neue Aufgabe. Ein Tauschgeschäft, das vielen vertraut ist.
So funktioniert der Transaktionale Führungsstil:
Die Führungskraft definiert Ziele, kontrolliert die Umsetzung und verbindet Erfolg mit Belohnung. Es geht um Ergebnisse, messbare Fortschritte und klare Erwartungen.
Dieses Prinzip funktioniert vor allem in Umgebungen, in denen Prozesse stabil laufen und der Weg zum Ziel kaum Überraschungen bereithält.
Das kann wirken, wenn:
Aufgaben eindeutig beschrieben sind, Routinen greifen und es vor allem darum geht, sauber zu liefern.
Hier schafft der transaktionale Stil Orientierung:
Menschen wissen, was von ihnen erwartet wird – und was sie dafür bekommen.
In einigen Bereichen, etwa im Vertrieb oder in der Qualitätssicherung, sorgt genau diese Klarheit für Tempo und Verlässlichkeit.
Aber:
Motivation bleibt bei diesem Führungsstil selten tief.
Sie entsteht nicht aus Sinn, Entwicklung oder Beziehung, sondern aus Belohnung.
Das funktioniert – bis jemand anders mehr bietet.
Oder bis der Stress steigt. Dann kippt die Balance schnell:
Menschen fühlen sich gedrängt, vergleichen sich, verlieren die Freude und oft auch die Bindung zum Team.
Dauerhafter Leistungsdruck macht eng. Und wenn nur das Ergebnis zählt, geht das Wesentliche verloren: Kreativität. Verantwortung. Begeisterung.
All das bleibt auf der Strecke, wenn Führung sich wie ein Vertrag anfühlt.
Resilient weitergedacht:
Leistung bleibt wichtig – aber sie entsteht nachhaltiger, wenn Menschen wissen, warum sie etwas tun.
Resiliente Führung verbindet Klarheit mit Sinn. Sie schafft Struktur, ohne Menschen zu überfrachten.
Sie fokussiert Qualität, ohne Druck als Werkzeug zu nutzen.
Resilient führen heißt:
Ich steuere über Klarheit – nicht über Druck.
So entsteht Leistung, die trägt.
Mit Energie, Verantwortung und echter Motivation – nicht nur mit Bonusmodellen.
Transaktionaler Führungsstil
So funktioniert er: Leistung gegen Belohnung – Ziele, Kontrolle, Boni.
Das kann wirken, wenn: Aufgaben klar und messbar sind.
Aber: Motivation bleibt extrinsisch, Bindung gering.
Resilient weitergedacht: Leistung ja, aber mit Sinn und Energie.
Resilient führen heißt: Ich steuere über Klarheit – nicht über Druck.
#6. Transformationaler Führungsstil
Der transformationale Führungsstil gehört zu jenen Ansätzen, die Menschen sofort spüren. Eine Führungskraft, die mit Visionen führt, bewegt etwas. Sie zeigt ein Bild der Zukunft, das größer ist als der aktuelle Status. Sie verbindet Ziele mit Sinn, Aufgaben mit Bedeutung und Menschen miteinander.
Viele Teams lieben genau das: jemanden, der Mut macht, der vorangeht, der inspiriert – gerade in Phasen, in denen Veränderung unausweichlich ist.
So funktioniert der Transformationale Führungsstil:
Die Führungskraft führt weniger über Anweisungen und viel mehr über Haltung.
Sie erklärt, warum etwas wichtig ist, nicht nur was zu tun ist.
Sie zeigt, wofür das Team arbeitet, welchen Beitrag alle leisten und was daraus entstehen kann.
Sie lebt vor, was sie erwartet – und das wirkt: Wenn jemand selbst Disziplin zeigt, Vertrauen schenkt oder mutige Entscheidungen trifft, steigt die Bereitschaft im Team, mitzuziehen.
Das kann wirken, wenn:
Wandel ansteht, Motivation gebraucht wird und Menschen Orientierung suchen.
Transformational Leadership entfaltet besonders dann Kraft, wenn Teams spüren:
„Meine Arbeit bedeutet etwas. Ich bin Teil eines größeren Ganzen.“
In Innovationsprojekten, in Change-Situationen oder in Phasen, in denen Visionen gefragt sind, geben solche Führungskräfte Halt – nicht durch Kontrolle, sondern durch Perspektive.
Aber:
Auch Inspiration hat eine Grenze.
Wenn alles ständig „visionär“ sein muss, bleibt irgendwann keine Luft mehr.
Teams können sich überfordert fühlen, wenn der Anspruch an Begeisterung zum Dauerzustand wird.
Nicht jeder Tag ist ein Aufbruch. Nicht jede Aufgabe ist ein Meilenstein.
Manchmal brauchen Menschen weniger Vision – und mehr Ruhe.
Weniger Aufbruch – und mehr Struktur.
Weniger „Wow“ – und mehr „Was ist jetzt konkret dran?“
Ohne diese Balance kann transformationaler Stil Druck erzeugen, auch wenn er gut gemeint ist.
Resilient weitergedacht:
Begeisterung bleibt wichtig – aber sie braucht Erdung.
Resilient Leadership verbindet Vision mit Realismus.
Es inspiriert, ohne zu überdrehen. Es schafft Richtung, ohne Tempo aufzuzwingen.
Es erkennt, wann das Team bereit ist – und wann es erst einmal Stabilität braucht.
Resilient führen heißt:
Ich inspiriere – ohne zu überfordern.
So entsteht Führung, die bewegt, ohne auszubrennen.
Führung, die Menschen stärkt, ohne sie unter Druck zu setzen.
Und Führung, die Wandel möglich macht – weil sie die Menschen mitnimmt, nicht antreibt.
Transformationaler Führungsstil
So funktioniert er: Führung durch Vision, Sinn, Vorbild.
Das kann wirken, wenn: Wandel und Motivation gefragt sind.
Aber: Dauer-Inspiration überfordert.
Resilient weitergedacht: Begeisterung braucht Erdung.
Resilient führen heißt: Ich inspiriere – ohne zu überfordern.
Immer dienstags spannende Impulse über Business-Resilienz, wertschätzende Führung und menschliche Arbeitskultur
Melde dich einfach zu meinem Newsletter an!
(Du kannst dich jederzeit wieder schnell abmelden.)
#7. Charismatischer Führungsstil
Charismatische Führungskräfte haben etwas, das man nicht gut beschreiben kann, aber sofort spürt. Sie betreten den Raum – und die Energie verändert sich. Menschen hören ihnen zu, weil sie wollen, nicht weil sie müssen. Sie bewegen durch Präsenz, Ausstrahlung und eine natürliche Fähigkeit, andere mitzunehmen.
Charisma entsteht selten aus Technik. Es entsteht aus Haltung, Klarheit und Authentizität. Und ja: aus einem gewissen Funken, der Menschen berührt.
So funktioniert der Charismatischer Führungsstil:
Die Führungskraft führt über Persönlichkeit.
Sie begeistert, erzählt, zeigt Emotionen, öffnet sich – und schafft Verbindung.
Sie inspiriert durch ihr Auftreten, ihre innere Überzeugung, ihre Art zu kommunizieren.
Menschen folgen, weil sie sich gemeint fühlen.
Oft reicht ein Satz, ein Blick, ein Bild, um ein Team in Bewegung zu bringen.
Das kann wirken, wenn:
Veränderung ansteht, Unsicherheit herrscht oder ein neuer Weg sichtbar werden muss.
In solchen Momenten brauchen Teams jemanden, der Mut macht und Orientierung gibt –
ohne lange PowerPoint-Schlachten, sondern durch Glaubwürdigkeit und Energie.
Charismatische Führung wirkt besonders, wenn Menschen zweifeln:
„Geht das wirklich?“
Ein charismatischer Leader schafft es, die Angst zu verkleinern und die Zuversicht zu stärken.
Aber:
Charisma hat zwei Seiten.
Es wirkt stark – manchmal zu stark.
Menschen können abhängig werden von der Person, statt Verantwortung selbst zu tragen.
Manchmal blenden charismatische Führungskräfte auch:
Sie faszinieren, aber sie führen nicht unbedingt nachhaltig.
Teams können sich von der Energie tragen lassen – und übersehen, dass es an Struktur, Klarheit oder echten Entscheidungen fehlt.
Und es kann passieren, dass Führung sich zu sehr um die Person dreht – statt um die Aufgabe, das Team oder die Sache.
Resilient weitergedacht:
Wirkung bleibt wertvoll – aber sie braucht Boden.
Resilient Leadership nutzt Charisma, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen.
Es setzt Energie bewusst ein, nicht um zu beeindrucken, sondern um Verbindung zu schaffen.
Es bleibt präsent – und gleichzeitig transparent.
Es führt über Haltung, nicht über Bühne.
Resilient führen heißt:
Ich nutze Präsenz, nicht Macht – und setze Energie bewusst ein.
So entsteht Führung, die wirklich trägt:
kraftvoll, aber nicht laut.
authentisch, aber nicht inszeniert.
einflussreich, ohne abhängig zu machen.
Eine Führung, die inspiriert – und gleichzeitig stabil bleibt.
Charismatischer Führungsstil
So funktioniert er: Die Persönlichkeit der Führungskraft begeistert, beeinflusst, zieht an.
Das kann wirken, wenn: Veränderung, Unsicherheit oder Aufbruch angesagt sind.
Aber: Charisma kann Abhängigkeit schaffen – oder blenden.
Resilient weitergedacht: Wirkung ja – aber ohne Ego.
Resilient führen heißt: Ich nutze Präsenz, nicht Macht – und setze Energie bewusst ein.
#8. Dienender Führungsstil (Servant Leadership)
Der dienende Führungsstil berührt viele Menschen, weil er etwas in Führung zurückbringt, das oft verloren geht: echte Unterstützung. Statt vorne zu stehen und Richtung vorzugeben, stellt sich die Führungskraft bewusst hinter ihr Team. Sie räumt Hürden aus dem Weg, klärt Konflikte, organisiert Ressourcen und schafft Räume, in denen Menschen wachsen können.
Dieser Stil basiert auf einem einfachen Gedanken:
„Ich bin dafür da, mein Team stark zu machen.“
Nicht durch Kontrolle – sondern durch Vertrauen, Empathie und echtes Interesse an der Entwicklung jedes Einzelnen.
So funktioniert der Dienende Führungsstil (Servant Leadership):
Die Führungskraft beobachtet, wo das Team Energie verliert, und greift unterstützend ein.
Sie hält den Rücken frei, moderiert, entfernt Blockaden und fördert Eigenverantwortung.
Es geht nicht darum, zu glänzen – sondern darum, das Team glänzen zu lassen.
Servant Leader schaffen ein Klima, in dem Menschen ausprobieren, sich einbringen und Verantwortung übernehmen wollen, nicht müssen.
Das kann wirken, wenn:
Ein Team bereits Reife, Kompetenz und Eigenorganisation mitbringt.
Dienen entfaltet seine ganze Kraft, wenn Menschen Lust haben, selbst zu gestalten – und eine Führung haben, die ihnen vertraut und ihnen die dafür nötigen Freiräume gibt.
In agilen Umfeldern, in selbstorganisierten Teams oder in Projekten mit starkem Fachbezug wirkt dieser Stil besonders nachhaltig. Menschen wachsen, weil sie sich getragen fühlen – nicht geführt im klassischen Sinne.
Aber:
Auch hier gibt es einen Kipppunkt.
Dienende Führung kann schnell in Selbstaufgabe rutschen:
Wenn die Führungskraft zu viel abnimmt, zu viel unterstützt, zu viel auffängt.
Dann verschwimmen Zuständigkeiten, und das Team verliert die Orientierung:
Wer entscheidet? Wer trägt Verantwortung? Was ist meine Rolle?
Dienende Führung darf nicht bedeuten, dass die Führungskraft ihre eigene Kraft opfert – oder dass sie Führung mit Nettigkeit verwechselt.
Resilient weitergedacht:
Unterstützung bleibt zentral, aber sie braucht Haltung.
Resilient Leadership hilft, zwischen hilfreicher Unterstützung und ungesunder Aufopferung zu unterscheiden.
Es schafft Nähe, ohne sich selbst zu verlieren.
Und es stellt die Entwicklung des Teams über kurzfristige Harmonie.
Resilient führen heißt:
Ich helfe anderen zu wachsen – und achte auf meine eigene Kraft.
So entsteht Führung, die stärkt, statt zu erschöpfen.
Führung, die Verantwortung teilt, ohne sie abzugeben.
Und Führung, die für andere da ist – ohne sich selbst zu vernachlässigen.
Dienender Führungsstil
(Servant Leadership)
So funktioniert er: Führungskräfte unterstützen ihr Team, beseitigen Hindernisse, fördern Entwicklung.
Das kann wirken, wenn: Vertrauen und Reife vorhanden sind.
Aber: Gefahr der Selbstaufgabe oder unklarer Zuständigkeit.
Resilient weitergedacht: Dienen braucht Haltung, keine Aufopferung.
Resilient führen heißt: Ich helfe anderen zu wachsen – und achte auf meine eigene Kraft.
#9. Empathischer Führungsstil
Empathische Führung berührt – im besten Sinn. Sie schafft Nähe und Vertrauen dort, wo Menschen oft unsicher sind, zögern oder nicht sagen, was sie wirklich brauchen. Eine empathische Führungskraft hört nicht nur zu. Sie nimmt wahr, was zwischen den Zeilen passiert. Sie merkt, wenn jemand erschöpft wirkt, wenn sich ein Konflikt anbahnt oder wenn ein Teammitglied sich zurückzieht.
Empathie sorgt dafür, dass Menschen sich gesehen fühlen – nicht als Ressource, sondern als Mensch. Und genau das verändert das Klima in einem Team.
So funktioniert der Empathische Führungsstil:
Die Führungskraft nimmt Emotionen ernst.
Sie fragt nach, hört aktiv zu, stellt offene Fragen und zeigt echtes Interesse.
Sie versucht zu verstehen, warum jemand so reagiert, wie er reagiert – statt vorschnell zu urteilen.
Gespräche verlaufen ruhiger, klarer und ehrlicher, weil sich Menschen trauen, mehr von sich zu zeigen.
Das kann wirken, wenn:
Ein Team psychologische Sicherheit braucht.
Wenn Menschen unter Druck stehen oder Veränderungen bevorstehen.
Empathische Führung schafft dann etwas, das in vielen Organisationen fehlt: ein Gefühl von „Wir schaffen das gemeinsam“.
Offenheit wächst. Fehlerthemen kommen früher auf den Tisch.
Konflikte entzünden sich weniger, weil sich niemand übersehen oder übergangen fühlt.
Aber:
Auch Empathie kann kippen.
Wenn Führung zu sehr auf das Gefühl anderer reagiert, verliert sie manchmal den eigenen Standpunkt.
Entscheidungen werden verschoben, weil jemand sich unwohl fühlt.
Grenzen verschwimmen, weil man niemanden enttäuschen will.
Und irgendwann trägt die Führungskraft Emotionen, die nicht ihre eigenen sind.
Das ist nicht empathisch – das ist übergriffig zu sich selbst.
Resilient weitergedacht:
Mitfühlen ja – aber ohne mitzuleiden.
Resilient Leadership setzt auf emotionale Präsenz, ohne die eigene Klarheit zu verlieren.
Es erkennt Gefühle an, ohne sich von ihnen steuern zu lassen.
Und es hält Entscheidungen, auch wenn jemand im Team sie nicht sofort gut findet.
Empathie wird dadurch nicht kleiner – sie wird tragfähiger.
Resilient führen heißt:
Ich sehe Menschen – und halte Führung.
So entsteht eine Führung, die Herz zeigt, ohne die Richtung zu verlieren.
Eine Führung, die Menschen ernst nimmt – und gleichzeitig handlungsfähig bleibt.
Eine Führung, die Nähe schafft, ohne sich selbst zu verlieren.
Empathischer Führungsstil
So funktioniert er: Emotionen wahrnehmen, zuhören, Verständnis zeigen.
Das kann wirken, wenn: Offenheit und psychologische Sicherheit gebraucht werden.
Aber: Entscheidungen können vertagt, Grenzen verwischt werden.
Resilient weitergedacht: Mitfühlen ohne mitzuleiden.
Resilient führen heißt: Ich sehe Menschen – und halte Führung.
#10. Laissez-faire / Vertrauensbasierter Führungsstil
Laissez-faire klingt im ersten Moment nach Weite, nach Freiheit, nach Raum zum Atmen. Führung tritt bewusst einen Schritt zurück, das Team gestaltet vieles selbst und entscheidet im Alltag, was sinnvoll ist.
Für Menschen, die gern eigenverantwortlich arbeiten, fühlt sich das zunächst wie ein Geschenk an.
Doch wie bei jedem Führungsstil entscheidet nicht der Name, sondern die Haltung dahinter.
So funktioniert der vertrauensbasierte Führungsstil (Laissez-faire):
Die Führungskraft greift nur ein, wenn es wirklich nötig ist.
Das Team organisiert sich selbst: Aufgaben, Prioritäten, Lösungen.
Die Führung zeigt Vertrauen, verzichtet auf Kontrolle und begleitet eher im Hintergrund.
Wenn alle im Team klar, eingespielt und gut vernetzt arbeiten, entsteht eine Form von Leichtigkeit, die selten ist. Menschen nutzen ihre Stärken, treffen mutige Entscheidungen und wachsen über sich hinaus.
Das kann wirken, wenn:
Ein Team reif ist, Erfahrung mitbringt und selbstständig arbeiten möchte.
Wenn Rollen klar sind und jede Person weiß, welche Verantwortung sie trägt.
In solchen Umfeldern braucht es keine ständige Führung, sondern gute Rahmenbedingungen.
Teams, die sich kennen, die gut kommunizieren und über Fachkompetenz verfügen, genießen genau diesen Freiraum. Er ermöglicht Kreativität, Tempo und echte Ownership.
Aber:
Laissez-faire kann schnell falsch verstanden werden.
Wenn Führung komplett abtaucht oder Konflikte ignoriert, entsteht kein Freiraum – sondern Unsicherheit.
Menschen fühlen sich allein gelassen, Abstimmungen dauern länger, und irgendwann weiß niemand mehr, wer eigentlich entscheidet.
Überforderung kann sich leise einschleichen:
Die einen übernehmen zu viel, die anderen zu wenig.
Manchmal wirkt „Vertrauen schenken“ wie „Führung vermeiden“.
Und dann kippt die Stimmung – von Freiheit zu Chaos.
Resilient weitergedacht:
Vertrauen ist wertvoll – aber es ist kein Rückzug.
Resilient Leadership bedeutet, Freiraum bewusst zu geben, ohne die Verbindung zu verlieren.
Es heißt: loslassen, aber nicht verschwinden.
Es heißt: dem Team etwas zutrauen – und trotzdem präsent bleiben, wenn Orientierung gebraucht wird.
Resilient führen heißt:
Ich gebe Freiraum – und bleibe verbunden.
So entsteht ein Umfeld, in dem Selbstorganisation trägt, statt zu überfordern.
Ein Raum, in dem Menschen wachsen, ohne allein gelassen zu werden.
Und eine Führung, die nicht im Vordergrund steht – aber spürbar bleibt, wenn es darauf ankommt.
Vertrauensbasierter Führungsstil
(Laissez-faire)
So funktioniert er: Führung tritt in den Hintergrund, das Team arbeitet weitgehend eigenverantwortlich.
Das kann wirken, wenn: das Team reif, erfahren und selbstorganisiert ist.
Aber: fehlende Führung kann zu Chaos, Überforderung oder Demotivation führen.
Resilient weitergedacht: Vertrauen ist kein Rückzug, sondern ein bewusstes Loslassen.
Resilient führen heißt: Ich gebe Freiraum – und bleibe verbunden.
#11. Situatives Führen (nach Hersey & Blanchard)
Situatives Führen gehört zu den Ansätzen, die im ersten Moment logisch wirken – und im Alltag trotzdem herausfordernd sind. Die Idee ist simpel: Nicht jedes Team braucht denselben Führungsstil. Und nicht jede Person braucht zu jeder Zeit dieselbe Art von Unterstützung oder Freiheit.
Führung passt sich an den Reifegrad, die Erfahrung und die Motivation des Teams an.
Nicht starr, sondern bewusst. Nicht aus Reflex, sondern aus Beobachtung.
So funktioniert das Situatives Führen (nach Hersey & Blanchard):
Situatives Führen bewegt sich zwischen vier Grundstilen:
1️⃣ Anleiten (Telling) – viel Führung, wenig Autonomie
… wenn eine Person noch wenig Erfahrung hat und Orientierung braucht.
2️⃣ Überzeugen (Selling) – erklären, motivieren, mitnehmen
… wenn jemand zwar motiviert ist, aber noch nicht sicher genug handelt.
3️⃣ Beteiligen (Participating) – zuhören, gemeinsam entscheiden
… wenn Kompetenz da ist, aber vielleicht die Motivation schwankt.
4️⃣ Delegieren – Verantwortung übertragen
… wenn ein Teammitglied reif genug ist, selbstständig zu arbeiten.
Diese vier Stile bilden kein Bewertungssystem – sondern einen Bewegungsraum, durch den sich Führung je nach Situation bewegt.
Das kann wirken, wenn:
Führungskräfte ihr Team und die einzelnen Teammitglieder wirklich wahrnehmen.
Wenn sie erkennen, was gerade gebraucht wird – nicht, was ihnen selbst am bequemsten erscheint.
Situatives Führen hilft dabei, Menschen weder zu überfordern noch zu unterfordern.
Es schafft Entwicklungsschritte:
Vom „Ich brauche Anleitung“ hin zu „Ich trage Verantwortung“ – ohne Druck, sondern mit Bewusstsein und Unterstützung.
Aber:
Situatives Führen ist anspruchsvoll.
Es verlangt Selbstreflexion, Präsenz und eine ehrliche Einschätzung der eigenen Wirkung.
Es erfordert offene Kommunikation – und die Bereitschaft, den eigenen Stil immer wieder anzupassen.
Und ja: Es ist leichter, immer gleich zu führen, als jeden Menschen in seinem Entwicklungsstand zu sehen.
Doch genau das unterscheidet Führung, die verwaltet, von Führung, die entwickelt.
Resilient weitergedacht:
Anpassungsfähigkeit bleibt wichtig, aber sie braucht innere Stabilität.
Resilient Leadership geht einen Schritt weiter:
Es setzt nicht nur auf Flexibilität im Außen, sondern auch auf Bewusstheit im Innen.
Es hilft dir, klar zu bleiben, selbst wenn dein Team unterschiedliche Bedürfnisse hat.
Du reagierst nicht impulsiv – du entscheidest bewusst.
Resilient führen heißt:
Ich bleibe flexibel – und innerlich stabil.
So entsteht eine Führung, die Menschen wachsen lässt, ohne sich selbst zu verlieren.
Eine Führung, die Situationen erkennt – und bewusst gestaltet.
Situatives Führen
(nach Hersey & Blanchard)
So funktioniert es: Der Führungsstil richtet sich nach Reifegrad, Erfahrung und Motivation des Teams.
Das kann wirken, wenn: Führungskräfte bewusst wahrnehmen und anpassen.
Aber: erfordert Selbstreflexion und Kommunikationsstärke.
Resilient weitergedacht: Situativ ist anpassungsfähig – Resilient ist bewusst.
Resilient führen heißt: Ich bleibe flexibel – und innerlich stabil.
#12. Führung in Deutschland – stark in Struktur, schwach in Beziehung
Wenn man deutsche Führungskultur in wenigen Worten beschreiben müsste, würden viele sagen: klar, zuverlässig, fachlich stark. Und ja – das stimmt. Deutsche Führung baut traditionell auf Präzision, Planung und technische Kompetenz.
Man verlässt sich auf Prozesse, Standards und klare Zuständigkeiten. Entscheidungen sind sauber vorbereitet, Risiken kalkuliert, Abläufe durchdacht.
Diese Stärke hat unser Wirtschaftssystem lange getragen.
Sie gibt Sicherheit, schafft Qualität und macht Komplexes handhabbar.
Doch diese Stärke hat auch eine Kehrseite – und darüber sprechen wir oft zu wenig.
So funktioniert die Führung in Deutschland (noch):
Die meisten Führungskräfte in Deutschland führen aufgabenorientiert.
Sie steuern über Kontrolle, Struktur und Fachlogik.
Es geht darum, sauber zu arbeiten, Ziele zu erreichen und Fehler zu vermeiden.
In vielen Unternehmen fühlt sich Führung deshalb eher nach Projektmanagement an – nicht nach Beziehung oder Entwicklung.
Das kann wirken, wenn:
Prozesse im Vordergrund stehen.
Wenn es darum geht, Qualität zu sichern, Risiken zu minimieren oder Prozesse stabil laufen zu lassen.
Deutsche Präzision ist kein Klischee. Sie wirkt – vor allem dort, wo Verlässlichkeit den Unterschied macht.
Aber:
In einer Arbeitswelt, die immer stärker von Dynamik, Emotionen, Veränderung und menschlicher Komplexität geprägt ist, reicht das nicht mehr.
Die technischen Stärken der deutschen Führung sind wertvoll – doch oft fehlt der zweite Teil:
· soziale Kompetenz
· echtes Zuhören
· Feedback, das nicht nur kritisiert, sondern stärkt
· Gespräche über Sinn und Zusammenarbeit, nicht nur über Aufgaben
· Mut, über Belastung, Erschöpfung oder Spannungen und Konflikte zu sprechen
Viele Teams spüren genau das:
Sie laufen, funktionieren, liefern – aber sie fühlen sich nicht verbunden.
Sie sind eingebunden – aber nicht einbezogen.
Sie wissen, was sie tun sollen – aber nicht, warum es wichtig ist.
Diese Lücke macht auf Dauer müde.
Manche nennen es „innere Kündigung“. Andere nennen es „Dienst nach Vorschrift“.
Es ist aber vor allem eines: ein Zeichen, dass Beziehung fehlt.
Resilient weitergedacht:
Resilient Leadership verbindet die deutsche Stärke für Struktur mit etwas, das lange unterschätzt wurde: Menschlichkeit.
Es hält an Präzision fest – aber nicht auf Kosten der Menschen, die sie täglich liefern.
Es schafft Klarheit und gleichzeitig Raum für Emotionen.
Es führt über Verantwortung und Empathie – nicht über Kontrolle und Distanz.
Es sagt nicht: „Entweder Struktur oder Beziehung.“
Sondern: „Beides – und bewusst.“
Resilient führen heißt:
Ich kombiniere Präzision mit Menschlichkeit – und bleibe echt.
So entsteht eine Führung, die weder kalt noch chaotisch ist.
Eine Führung, die Leistung möglich macht, ohne Menschen zu verlieren.
Und eine Führung, die nicht nur Ziele erreicht – sondern Sinn stiftet, Vertrauen schafft und Zukunft baut.
Führung in Deutschland
So funktioniert sie (noch): aufgabenorientiert, kontrollbasiert, technisch versiert.
Das kann wirken, wenn: Prozesse im Vordergrund stehen.
Aber: soziale Kompetenz, Feedback und Sinn fehlen oft.
Resilient weitergedacht: Struktur trifft Beziehung.
Resilient führen heißt: Ich kombiniere Präzision mit Menschlichkeit – und bleibe echt.
FAZiT – Resilient Leadership: Das Update für Führung
Führung verändert sich.
Kein Stil reicht allein, aber jeder bringt wertvolle Elemente mit.
Resilient Leadership integriert sie alle:
· Autorität mit Ruhe,
· Kooperation mit Klarheit,
· Leistung mit Sinn,
· Empathie mit Grenzen,
· Vertrauen mit Verantwortung.
Resilient führen heißt: bewusst, klar und menschlich bleiben – gerade dann, wenn’s schwierig wird.
Führung verändert sich – und das spürt jede Führungskraft, die heute Verantwortung trägt. Die Anforderungen werden breiter, die Erwartungen komplexer, der Druck höher. Klassische Führungsstile geben Orientierung, aber keiner reicht allein. Jeder Stil zeigt nur einen Ausschnitt davon, was moderne Führung braucht.
Und doch bringt jeder von ihnen etwas Wertvolles mit:
eine bestimmte Haltung, eine Stärke, eine Perspektive.
Resilient Leadership denkt all diese Elemente weiter – nicht als neues Modell, sondern als bewusste Haltung, die Führung stabil, klar und menschlich macht.
Es verbindet das, was oft getrennt wirkt:
Autorität mit Ruhe – klar führen, ohne zu dominieren.
Kooperation mit Klarheit – beteiligen, ohne sich zu verlieren.
Leistung mit Sinn – Ergebnisse erreichen, ohne Menschen zu überfordern.
Empathie mit Grenzen – fühlen, ohne mitzuleiden.
Vertrauen mit Verantwortung – Freiraum geben, ohne abzutauchen.
Resilient Leadership ist kein Stil.
Es ist der Rahmen, der alle Stile tragfähig macht – vor allem dann, wenn es schwierig wird, wenn Druck steigt, wenn Teams Halt brauchen und Führung gefordert ist.
Resilient führen heißt:
bewusst handeln, klar kommunizieren und menschlich bleiben –
auch dann, wenn der Alltag überfordert.
So entsteht Führung, die nicht nur funktioniert, sondern wirkt.
Führung, die stärkt.
Führung, die Zukunft möglich macht.
Und wenn du gerade denkst: „Ich möchte herausfinden, wo ich stehe – und wie ich mich innerlich besser aufstellen kann“ – dann mach gern den ersten kleinen Schritt:
📥 Hol dir jetzt meinen RESILIENZ-TEST für 0,-
Denn innere Stärke beginnt nicht irgendwann. Sie beginnt genau heute – mit dir.
Wichtige HINWEISE für DICH:
Meine Strategien sind nur Ideen und Impulse, damit Du Dich inspirieren lassen kannst.
Sie ersetzen weder einen professionellen Check beim Facharzt noch eine Therapie.
Wenn ich beispielsweise von KUNDEN, KLIENTEN oder MITARBEITERN spreche, sind damit MENSCHEN aller GESCHLECHTER und IDENTITÄTEN gemeint.
Alle Namen und alle dargestellten Fälle wurden zu Illustrationszwecken verändert.
Diese Artikel könnten auch interessant für Dich sein:
Speichere dir diesen Artikel bei Pinterest: